|
|
|
Über die ungarische Kerbschrift
|
|
|
Klára
Friedrich: |
Was ist
Kerbschrift?
Kerbschrift
ist eine charakteristische, linienhafte, mehrheitlich aus Buchstaben mit geradliniger
Form bestehende alte Schriftart, die auf jeden Schriftträger (Stein, Holz, Metall,
Pergament, Papier, Seide, usw.) angewendet werden kann. Das ungarische Wort
rovásirás (Kerbschrift) ist der Hauptbegriff, darunter als Teilbegriff
wird rovás (Ritz) benützt, wenn die Schrift eingeritzt, geschnitzt oder
eingekerbt wird, d.h. als die Buchstaben in die Oberfläche vertieft werden.
Der Begriff der computerisierten Kerbschrift gehört auch zum Hauptbegriff rovásirás
(Kerbschrift).
Auch andere
Völker verfügen über Kerbschriftdenkmäler, wie pelasgische, phönizische, etruskische,
lateinische, griechische, germanische, türkische Schriften davon zeugen, aber
aufgrund meiner schriftgeschichtlichen Forschungen komme ich zur Schlussfolgerung,
dass sich diese aus der Kerbschrift der Vorfahren der Ungarn entwickelt haben.
Für deutsche
Leser kann es interessant sein, wenn wir bedenken, dass das Wort Rune zu einer
homonymen Wurzel *rün-'Einritzung' gehört. Auf Ungarisch heißt ró- (Wurzel),
róni (Inf.) = kerben, ritzen, aus welcher Wurzel das Wort rovás kommt. (T.M.)
Unsere Nationalschrift,
die ungarische Kerbschrift haben wir von unseren skythischen, hunnischen und
awarischen Vorfahren geerbt. Dank den aufgefundenen archäologischen und sonstigen
Gegenstandsdenkmälern können wir behaupten, dass dies die erste Schrift auf
Erden ist, in der einem Laut ein Buchstabe entspricht.
Die Kerbschrift
ist also ein alter und wertvoller kulturgeschichtlicher Schatz der Ungarn, die
edelste Form der Traditionstreue. Unsere Chronisten und Geschichtsschreiber
erwähnen oft diese Schrift: Simon KÉZAI, Márk KÁLTI, János THURÓCZY, Antonio
BONFINI, Antal VERANCSICS, István SZAMOSKÖZI, Mátyás BÉL haben sie skythisch-hunnische
Schrift genannt. Die Benennung 'rovásirás' ist Mihály TAR, der sie von seinen
Hirtenvorfahren gelernt hat, und János FADRUSZ, Bildhauer der berühmtesten Reiterstatue
von König Matthias in Kolozsvár (heute Cluj in Rumänien) zu danken. Die Bezeichnung
drückt die Charakteristik der Schriftart perfekt aus: sie kann in Holz geritzt,
in Stein graviert, auf Papier geschrieben werden. Sie wird auch sekler-ungarische
Schrift genannt, da die meisten Schriftdenkmäler bei den Seklern in Siebenbürgen
aufbewahrt sind. Dass sie auch nach dem Jahr 1945 erhalten blieb, ist der Pfadfinderbewegung
zu danken.
Unsere Kerbschrift
hat sich zusammen mit unserer Sprache entwickelt, weil jedem Laut des Ungarischen
ein Zeichen entspricht. Deshalb können wir sagen, dass es unsere eigene Schrift
ist, und wurde nicht von einem anderen Schriftsystem übernommen. Sie ist eine
Buchstabenschrift, mit der Entsprechung jeden Lautes einem Zeichen, so kann
sogar ein abstrakter Begriff schriftlich festgehalten werden. Als im 10.-11.
Jahrhundert in Ungarn die Schrift mit lateinischen Buchstaben verwendet wurde,
war die Schreibkunst mit der Tatsache konfrontiert, dass 13 ungarische Laute
keinen entsprechenden Buchstaben hatten (TY, GY, NY, LY, SZ, ZS, CS, K, J, Á,
É, Ö, Ü). Es war so nicht möglich, die ungarische Sprache auf geeigneter Weise
aufzuzeichnen und dies hat unser Schrifttum in der Entwicklung ziemlich verhindert.
Die Kerbschriftdenkmäler
zeugen davon, dass die Ungarn im Karpatenbecken Ureinwohner sind. Es gibt den
15-20 000 Jahre alten Knochenstab, die 7-8 000 Jahre alte beschriftete Scheibe
aus Tatárlaka, oder die neusteinzeitliche Scheibensammlung mit Schriftzeichen
von Zsófia Torma (1832-1899), der Archäologin aus Siebenbürgen. Die beiden Letztgenannten
gehören zur Tordos-Vinca-Kultur, die 5500-3000 v.Chr. florierte. Die Form der
in Ton geritzten Zeichen ist mit den Schriftzeichen der alten ungarischen Schrift
identisch.
Die Kerbschrift
liefert einen weiteren Beweis für die skythisch-hunnisch-awarisch-ungarische
Kontinuität, da sie auf archäologischen und Gegenstandsdenkmälern dieser Völker
vorhanden ist. Z.B. auf der 2700 Jahre alten skythischen Silbertasse, in der
hunnischen Felseninschrift in Russland, auf einer awarischen Nadelbüchse, auf
dem Stabkalender aus der Zeit der Arpaden-Dynastie. Der Grieche Agathon erwähnt
das Schrifttum unsere skythisch-hunnischen Vorfahren im 3. Jahrhundert v.Chr;
so auch der syrisch-griechische Reisende Lucianos im 2. Jahrhundert n.Chr.,
der griechische Wissenschaftler Priscos, der beim Hunnenkönig Attila als Botschafter
zu Besuch war im 5. Jahrhundert.
Die Kerbschrift
liefert weiterhin einen Beweis dafür, dass die ganze Bevölkerung schriftkundig
war in einer Zeitperiode, als der Kaiser Karl der Grosse nicht schreiben konnte,
wie das sein Biograph Einhard behauptet. Aus dieser Periode stammt die Nadelbüchse
aus Knochen, das in einem awarischen Frauengrab bei Szarvas gefunden wurde.
Darin waren 60 Kerbzeichen eingeritzt. Kerbschrift war in Ungarn noch im 19.-20.
Jahrhundert bei den Hirten in Gebrauch. Im Jahr 1802 war in Kiskunhalas ein
Bericht mit 160 Wörtern auf 16 Kerbstöcke geritzt und der Notar der Stadt war
fähig, den Bericht zu lesen.
Die Kerbschrift
widerspricht der Behauptung, dass die Ungarn erst nach dem Jahr 1000 von aus
dem Westen importierten Geistlichen lesen und schreiben gelernt hätten, wie
auch der Theorie des finnougrischen Ursprungs der Ungarn und der Sprachverwandtschaft.
Die meist
bekannten Objekte mit Kerbinschrift
Die bei Szarvas
gefundene Nadelbüchse aus Knochen aus der Awarenzeit ist im Museum Sámuel Tessedik
in Szarvas ausgestellt.
Ein Taufbecken
aus dem 13. Jahrhundert in Vargyas, Seklerland, in der von Imre Makovecz entworfenen
reformierten Kirche.
Die Kopie eines
Stabkalenders vom 12.-13. Jahrhundert aus Gyergyószárhegy, Seklerland, trägt
eine Inschrift mit fast 200 Wörtern. Der italienische Wissenschaftler und Kriegsingenieur
Luigi Ferdinando Marsigli hat ihn 1690 kopiert, das Objekt befindet sich in
einer Bibliothek in Bologna. Abbildung 1. Alphabet
auf diesem Stabkalender.

Abbildung 1.
Das sog. Alphabet von Nikolsburg wurde vor dem Jahr 1483 niedergeschrieben und wird heute in der Nationalbibliothek Széchényi in Budapest aufbewahrt. Abbildung 2.

Abbildung 2.
Die Kerbinschrift
auf der Kassettendecke in der Unitarierkirche in Énlaka (Seklerland) wurde 1668
gefertigt. Sie kann noch so lange angeschaut werden, bis der Holzwurm sie nicht
auffrisst.
Vom Jahr 1598
stammt ein Lehrbuch auf Latein mit dem Titel Rudimenta, oder Elemente der
alten Sprache der Hunnen. Verfasser war János Thelegdi, später katholischer
Würdenträger, Bischof von Nyitra und Erzbischof von Kalocsa. Er hat das Buch
mit 16 Seiten im Alter von 24 Jahren als Student in Leiden geschrieben. Nur
Manuskriptkopien sind erhalten geblieben.
Die Mehrheit
der ältesten, authentischen Kerbschrift-Alphabete bestehen aus 32 Buchstaben,
jedoch ohne lange Vokale. Den Buchstaben É finden wir bereits in einem Text
von Gáspár Miskolczi Csulyak vom Jahr 1654, sie wurde jedoch nicht allgemein
verbreitet. (Er war Sohn von István Miskolczi Csulyak, des Militärpfarrers des
Prinzen Gábor Bethlen. Er hat in Wittenberg und Heidelberg studiert.) Die allgemeine
Verbreitung der Buchstaben Á und É in Kerbschrift ist dem Ethnographieforscher
und Ornamentikkünstler Adorján Magyar (1887-1978) zu danken, so besteht das
Alphabet aus 34 Buchstaben.
Der Forscher Sándor Forrai, Lehrer von Steno und Dactylo hat die Kerbschrift auch in der Schule unterrichtet. Er wollte nicht, dass seine Schüler mit der akademischen Rechtschreibung in Konflikt geraten, so hat er in alten, authentischen Kerbinschriften für die fehlenden langen Vokale verwendbare Zeichen gesucht, darum besteht sein Alphabet aus 39 Buchstaben. Abbildung 3.
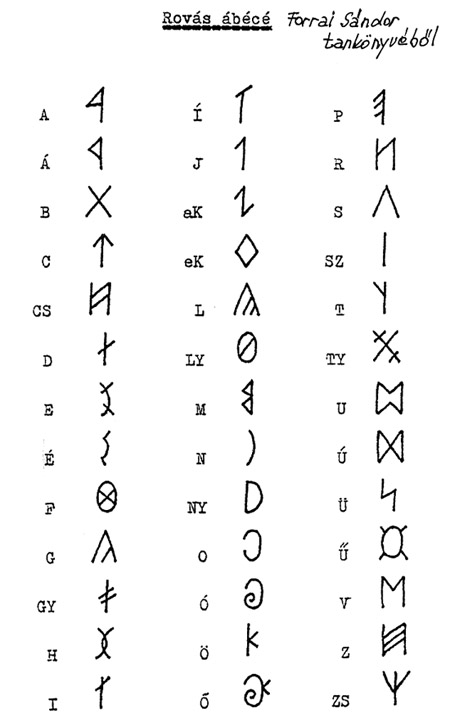
Abbildung 3.
Aufgrund meiner
Erfahrungen im Unterricht empfehle ich, mit dem Kerbschriftunterricht erst nach
Abschluss des 3. Schuljahres zu beginnen, nachdem die Schüler über stabile Grundkenntnisse
in Schreiben-Lesen-Rechtschreibung verfügen. Es gibt keine Altersgrenze - viele
Erwachsenen haben sich die Kerbschrift als Grosseltern angeeignet. Dafür ist
ein Beispiel die Mutter unserer Weltmeisterin im Schwimmen, Krisztina Egerszegi:
sie hat das ganze Gedicht János vitéz (Der Held János, Sándor Petőfi hat geschrieben.)
in Kerbschrift übertragen.
In der Verbreitung
und Bekanntmachung der Kerbschrift haben die von Gábor Szakács, Schriftsteller
und Journalist zwischen den Jahren 1997 und 2011 organisierten Veranstaltungen
und Wettbewerbe eine große Rolle gespielt. Er hat damit alle Kerbschriftlehrer
und Schüler im Karpatenbecken angesprochen, und sogar aus Stuttgart haben sich
Pfadfinder gemeldet. Dank diesen Bestrebungen und den Fachzirkeln wurde die
Kerbschrift zum Teil des Unterrichts und kann seit dem Jahr 2013 im Fach Landeskunde
unterrichtet werden.
János Baranyai Decsi, Lehrer der Reformierten Hochschule in Marosvásárhely im 16. Jahrhundert, hat sich über die Kerbschrift so geäußert: "...Diese Buchstaben kann jeder in kürzester Zeit mit Leichtigkeit... erlernen. Daher halte ich diese Buchstaben nicht nur würdig, dass sie in jeder Schule unterrichtet und den Kindern beigebracht werden, aber auch achtenswert, damit all unsere Landsleute, Kinder, Alte, Frauen, Adlige und Bauern, mit einem Wort, all diejenigen, die Ungarn genannt werden wollen, diese Schrift erlernen."
Die wichtigsten
Regeln der ungarischen Kerbschrift
Zusammenfassung durch Klára Friedrich
1. Die
ungarische Kerbschrift wird von rechts nach links geschrieben, da es in den
meisten Schriftdenkmälern so geschrieben wurde. Es ist möglich auch von links
nach rechts zu schrieben, diese Weise befolgt jedoch nicht die Tradition. In
diesem Fall müssen wir die Buchstaben umkehren. Die ältesten Schriften werden
von rechts nach links geschrieben, wie das Pelasgische, das Etruskische, das
Griechische, der Latein, aber auch die ägyptische hieratische Schrift.
In den Übungen
beim Lernen hat sich die auf Bild 4. dargestellte Reihenfolge der Buchstaben
bewährt.
2. Heute
trennen wir die Wörter mit Leerstelle voneinander. Den ersten Buchstaben von
Sätzen und Namen heben wir durch größere Form hervor. Interpunktionszeichen
sind dieselben, wie in der Schrift mit lateinischen Buchstaben, aber Fragezeichen,
Komma, Anführungszeichen kehren wir um.
3. In
der Kerbschrift werden zwei Sorten K verwendet: in Form eines Hakens und in
Form eines Quadrats. Die Regeln für ihre Verwendung im 20. Jahrhundert sind
in unseren Denkmälern nicht bestätigt, wie es meine Forschungen unterstützen,
daher empfehle ich für Anfänger, nur die Form eines Quadrats zu benützen. Das
entspricht verschiedenen alten, authentischen Kerbschriften. In alten Zeiten
hat man nicht nur diese Konsonanten: (e)F, (e)L, (e)M, (e)N, (e)NY, (e)R, (e)S,
(e)SZ mit einem vorangehenden e ausgesprochen, sondern jeder Konsonant. Also:
(e)B, (e)C, (e)CS... ...(e)K, und dieses K wir mit der Quadratform dargestellt.
4. Wichtige
Regel ist, dass wir in der heutigen Kerbschrift nur diejenigen Buchstabenvarianten
verwenden, die in einer alten Schrift vor dem 18. Jahrhundert schon vorkommen.
Nur so können wir die Authentizität bewahren.
5. In unserer alten Schrift gab es kein Q, X, Y, W, da diese nicht zum ungarischen Lautbestand gehören. Ihre Verwendung wird in der beigelegten Tabelle festgelegt. Abbildung 4.

Abbildung 4.
Literatur:
Thelegdi János "Rudimenta, Priscae hunnorum linguae..." azaz
a hunok régi nyelvének elemei... (1598, Ars Libri kiadó, 1994)
Csallány Dezső: A székely-magyar rovásírás emlékei (A Nyíregyházi Jósa
András Múzeum évkönyve, III. 1963)
Csallány Dezső: A magyar és az avar rovásírás (A Nyíregyházi Jósa András
Múzeum évkönyve, 1969, XI.)
Csallány Dezső: Rovásírásos emlékek a Kárpát-medencében (A Nyíregyházi
Jósa András Múzeum évkönyve, XII-XIV.1972)
Faulmann, Karl: Illustrierte Geschichte der Schrift (Wien, 1880)
Fehérné Walter Anna: Az ékírástól a rovásírásig, I-II. kötet (1975)
Ferenczi Géza: Székely rovásírásos emlékek (Székelyudvarhely, 1997)
Fischer Károly Antal: A hún-magyar írás és annak fennmaradt emlékei (1889,
Hun-idea Kiadó, 2005)
Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig (Antológia
Kiadó, 1994)
Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása (1996)
Friedrich, Johannes: Geschichte der Schrift (Heidelberg, 1966)
Friedrich Klára: Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (2003- 2011)
Friedrich Klára-Szakács Gábor: Kőbe vésték, fába rótták (2005)
Friedrich Klára-Szakács Gábor: Ősök és írások (2008)
Friedrich Klára: Írástörténeti áttekintő magyar szempontból (2010)
Friedrich Klára: Megfejtések könyve (2013)
Friedrich Klára: Felvidéki rovásemlékek (2014)
Gimbutas, Marija: The gods and goddesses of the old Europe (1974)
Gimbutas, Marija: The Living Goddesses (University of California Press,
1999)
Gimbutas, Marija: The language of the Goddess (Thames and Hudson, 2001)
Jakubovich Emil: A székely írás legrégibb ábécéi (Budapest, 1935)
Magyar Adorján: Ős magyar rovásírás (U.S.A., Warren, 1970)
Németh Gyula: A magyar rovásírás (Magyar Nyelvtudományi Közlöny, 1934)
Makkay János: A tartariai leletek (Akadémiai Kiadó, 1990)
Mandics György: Róvott múltunk (Irodalmi Jelen Kiadó, I-III, 2010-2011)
Németh Gyula: A magyar rovásírás (Magyar Nyelvtudományi Közlöny, 1934)
Roska Márton: A Torma Zsófia gyűjtemény (Kolozsvár, 1941)
Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás (1909, Tinta Kiadó, 2002)
Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei (1915)
Szakács Gábor: A kortárs rovásírás atyja (Beszélgetés Forrai Sándorral,
Magyar Demokrata, 2003/7)
Szakács Gábor: Az EMP jel titka (Magyar Demokrata, 2007/8)
Szakács Gábor: Marsigli, Magyarország fölfedezője Magyar Demokrata, 2008/46.)
Szakács
Gábor: Marsigli nyomdokain (Magyar Demokrata, 2011/6)
The Danube script in light of the Turdas and Tartaria discoveries
(Exhibition catalogue, National History Museum of Transylvania, 2009)
Winn, Shan, M.M: Pre writing in south-eastern Europe (Western Publishers,
1981)
|
|
|
Über die ungarische Kerbschrift
|
|
|